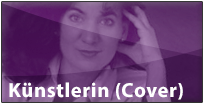Am darauffolgenden Wochenende lud Thomas seine Geschwister mit Frauen und die Eltern zu uns nach Hause zum Essen ein, damit wir doch ein bisschen feiern konnten. Er musste alles alleine bewältigen, die Einkäufe, das Essen zubereiten, die Kids halfen beim Tisch. Ich konnte zu dieser Zeit rein gar nichts machen. Und empfand mich oftmals als Last, das war natürlich mein Gefühl. Schrecklich für einen Menschen wie mich, der so agil, aktiv war, zusehen zu müssen, sich bedienen zu lassen – furchtbar! Ich hatte keinen Appetit, trotzdem bemühte ich mich zu Tisch und versuchte einige Bissen herunter zu bekommen. Es wurde mir derart schlecht und ich musste mich so lange übergeben, bis ich nichts mehr intus hatte. Ich ging ins Schlafzimmer und zog mich zurück. Meine Mama kam dann zu mir, ich konnte nur noch heulen. Und wollte meine Ruhe haben. Dies respektierten alle und ließen mich alleine. Aber auch für sie war das nicht angenehm, was gut vorstellbar ist.
Ab diesem Tag ging es stetig bergab. Mein Schwager ist Heilpraktiker und kam netterweise zu mir, (ich selbst konnte alleine nirgends hin) um meine gesamte Anamnese aufzunehmen. Meine Leberwerte hatten sich ziemlich verschlechtert, was mich zwar nicht zu sehr belastete, er aber hatte ein paar Tipps, um diese wieder verbesserungswürdig zu machen. Thomas besorgte mir sämtliche Mittel in der Apotheke und erst zu einem viel späteren Zeitpunkt wurden die Werte kontrolliert und siehe da, sie waren wesentlich besser, als zuvor!
Von da an nahm ich oftmals parallel zur Schulmedizin homöopathische Mittel, mit einem guten Gefühl und oftmals halfen diese unterstützend. Das immerhin ohne Nebenwirkungen! Jedoch achtete mein Schwager immer, wesentlich mehr als ich übrigens darauf, dass ich schulmedizinisch begleitet wurde, denn meist waren es meine schlimmsten Zeiten, in denen ich das gesamte Programm fuhr. Dennoch hatte ich ein “gutes” Gefühl dabei, so zum Beispiel auch bei einem Narbenspezifikum, das zur Wundheilung verabreicht wurde. Oder zu einem späteren Zeitpunkt, als es mir psychisch ganz miserabel ging. Ihm verdanke ich viel Geduld und sicherlich oftmals recht zeitintensive Prozesse, die er für mich investierte. Ich wusste das immer sehr zu schätzen!
Das Ergebnis der Punktion ergab nichts Außergewöhnliches, so dass sich der Verdacht des Arztes aus Offenbach nicht bestätigte.
Ich machte die Türe nicht mehr auf, blieb im Bett, was ich so nicht von mir kannte. Annette kam vorbei. Da ich dachte, es seien meine Schwiegereltern, die ihren Schlüssel vergaßen, öffnete ich. Ich hatte mich regelrecht zur Haustüre geschleppt, heulte und ging postwendend wieder ins Bett. Da wusste sogar Annette nicht mehr, was sie mir aufmunternd noch hätte mitteilen können. Ein paar Tage später rief ich Thomas im Geschäft an und teilte ihm mit, dass meine Entscheidung gefallen sei: entweder zu sterben oder zu kämpfen und diese OP mit allen Risiken, die damit verbunden waren, den Neurostimulator implantieren zu lassen – ich war am Ende meiner Kräfte!
Zunächst gab es nochmals einen Termin im Schmerzzentrum, da riet mir der Professor persönlich davon ab, denn dies sei dann nur für mein rechtes Bein, mein Rücken bliebe mir erhalten, ebenso ich ihnen als Patientin und würde trotz allem immer wieder für den Rücken, der kaputt sei, Morphium brauchen. Ich sollte mir das gut überlegen. Das hatte ich, denn trotz Morphium, das bei Nervenschmerzen dieser Art nicht zu helfen schien, hatte ich zerreißende Schmerzen, ich lag mittlerweile fast ein halbes Jahr, hatte zwei Kinder und einen Mann, den ich immer noch hatte. Aber wie lange würde er das mitmachen? Oder besser gesagt aushalten können? Und was war denn meine Lebensqualität? Nein, so wollte ich nicht mehr weiter leben.
Thomas nahm das dann in die Hand. Wir schrieben alle vorhandenen Fragen auf und er setzte sich mit meinem Neurochirurgen in Verbindung. Ich bekam einen schnellstmöglichen Termin.
Wir hatten Sting Karten für ein Open Air für ziemlich viel Geld gekauft. Ich dachte doch bis zuletzt daran, dass ich dies irgendwie bewältigen könnte. Da es dann ziemlich knapp wurde, und Thomas nicht mit jemand anderen gehen wollte, was ich sehr schade fand, verfielen diese Karten. Für uns doppelt teuer. Nicht dabei gewesen zu sein und finanziell.
Aber zunächst hieß es (wieder einmal!) mit den Kindern zu reden.
Das war nicht ganz einfach, vor allem für Lennert nicht. Der einzige Trost für ihn war, dass ich ihm erklärte, was für ein exotisches Gerät da in mich eingepflanzt werden sollte und dass er mich dann auch mal mit der Fernbedienung an- oder ausschalten dürfte. Das war natürlich obercool! Eine Mama, die man unter “Strom” setzen konnte. Na, das hatte ja wohl nicht jeder, oder?
So kam es, dass ich im Juni 2004 für 16 Tage stationär in die Neurochirurgie kam.
Annette brachte mich, wie fast immer hin. Dort wurde Narkosefähigkeit gemacht und OP besprochen.
Als ich dann fragte, ob ich über das Wochenende nochmals nach Hause durfte, war dagegen nichts einzuwenden. Ich kannte bereits einige vom Pflegepersonal, das war nicht schlecht. Meine Bettnachbarin, eine ganz junge Frau, hatte einen Kopftumor.
So holte mich Thomas samstags nach dem Frühstück ab und ich durfte bis Sonntag nachmittags zu Hause bleiben.
Der erste Eingriff verlief unter einer sogenannten “Analgosedierung”, das heißt man muss wach bleiben, damit man spüren kann, ob die Stimulation auch an der richtigen Stelle stattfindet. Ich wusste, dass ich für einige Zeit nicht duschen konnte, für mich eine Herausforderung! Ich stand als erste auf dem OP Plan, hatte keinen Wecker und schlief für meine Verhältnisse so gut, dass ich erst gegen kurz vor 7 Uhr aufwachte, das gab es noch nie! Ich eilte in die Dusche, genoss meine vorerst Letzte, zog mein Flügelhemdchen an.
Mein letztes Telefonat vor der OP mit Thomas, den einzigsten Menschen, den ich dann noch sprechen mochte!
Folglich konnte los gehen.
Da mich mein Neurochirurg recht gut kannte, und ich mich auch nicht von jedem hätte operieren lassen, stellte er mir den Monitor so hin, dass ich alles sehen konnte und erklärte mir synchron, was er gerade machte. Ich war fasziniert. Leider musste er das Kabel nochmals ganz herausziehen, was ein äußerst unangenehmer Moment für mich war. Es war, als würde er mir mein Hirn herausziehen. Beim zweiten Versuch lag es gut und ich konnte zum ersten Mal die Stimulation spüren. WAHNSINN! Ich hatte es mir nicht vorstellen können. So lagen nun die 4 Elektroden zwischen 11. und 12. Brustwirbel am Spinalkanal entlang, verliefen bis zum unteren Rücken, heraus kam ein dünnes Kabel, das entlang bis vorne zum Bauch festgeklebt wurde. Es gab ein externes Gerät, bei dem ich die Voltzahl ablesen konnte und sich damit sogar verstellen ließ. Danach musste ich mindestens 24 Stunden ganz flach auf dem Rücken liegen, damit sich die Elektroden nicht verschoben, ohne Kissen, absolut flach. Als ich wieder auf der Station war, hatte ich, wie immer nach solchen Aktionen, einen Bärenhunger. Ich lag über eine Woche alleine im Zimmer.
Da Roland zu der Zeit ebenfalls in der Klinik stationär war, kam er gerade und schaute nach mir; erschrak mich dermaßen, da er nicht zu sehen war und mich am Zehen pickte. Er war so lieb, mir ein Brötchen zu richten, so dass ich wenigstens etwas essen konnte – wie schwierig sich das im Liegen gestaltete, wusste ich ja bereits!
An diesem Tag kam abends Thomas, denn sonst möchte ich da niemanden sehen, da ich im Vorfeld nie weiß ,wie es mir ergeht. Leider tat ich mir immer wieder sehr schwer, Hilfe anzunehmen und wenn man bedenkt, dass ich da auf dem Rücken flach lag, kann man sich vielleicht doch vorstellen, dass ich praktisch Nichts machen konnte. Das Pflegepersonal konnte dies wohl nicht erkennen, so dass ich immer wieder Hilfe einfordern musste, was mir so schwer fiel. Zähne putzen im Liegen ist himmlisch, da läuft einem der Sabber hinten runter. Aber es war zum Glück eine absehbare Zeit. Am nächsten Morgen hatte ich immer noch mein wunderbares, heißgeliebtes Flügelhemd vom Vortag an. Ich hasse das sowieso und bin der Meinung, dass man noch kränker wirkt oder sich fühlt, als es eh schon ist. Zum Glück kam eine Freundin vorbei, die mir eine Waschschüssel brachte und fragte, ob ich denn etwas anderes anziehen könnte. Die Schwester meinte, das sei doch nicht schlimm ich könnte ja warten bis nach der Röntgenkontrolle. Es war Juni und sehr heiß. Ich wollte nicht warten, denn mein Bedürfnis nach Frische war stärker, war das so schwer zu verstehen? Dank der Hilfe der Freundin, konnte ich mich wenigstens notbedürftig waschen, so gut es eben ging im Liegen. Das Hemdchen musste ich allerdings noch anbehalten. Leider. Erst am Mittag nach 15 Uhr kamen die Schwestern und wollten mich gerade zum Röntgen bringen, als Mama mit unseren Kindern kam. Sie erschraken regelrecht, als sie mich sahen. Sage ich doch, es sieht dann immer schlimmer aus, als es tatsächlich ist. Lennert durfte sich aufs Bett setzen und fuhr mit hinunter im Fahrstuhl zum Röntgen. Da alles in Ordnung war (ich hatte auch wirklich versucht so starr wie möglich zu verharren!) und die Elektroden da saßen, wo sie sein sollten, durfte ich aufstehen und konnte mich “richtig” anziehen. Nun begann die Testphase, in der ich immer wieder meine Spannung hoch und wieder hinunter fuhr.
Es ging mir deutlich besser in der Schmerzintensität als zuvor. Das war ein enormer Erfolg, zumindest für mein rechtes Bein.
In dieser Zeit überraschte mich meine Freundin Diana immer wieder aufs Neue.
Sie besuchte mich unerschütterlich und war einfach präsent. Sie kam, brachte mir frisches, kleingeschnittenes Obst mit, das ich mit großem Genuss verzehrte, mit der Gewissheit, dass es mit Liebe für mich zubereitet worden war. Sie war für mich da, kam und tat mir unendlich gut! Was für ein Geschenk!
Ich bekam überhaupt viel Besuch, manchmal zuviel des Guten.
Aber andererseits freute ich mich auch immer sehr, zumal ich alleine im Zimmer lag und dazwischen durchaus meine Ruhe hatte. Wenn ich gerade telefonierte und mein Neurochirurg kam, meinte er: “Aha, Frau Stang hat wieder “Konferenz”.
So vergingen die Tage wenigstens einigermaßen.
Leider hatten die Ärzte einen durchaus großen Ehrgeiz, mich bis zum Ende des stationären Aufenthaltes morphiumfrei zu bekommen, um damit ihren Erfolg zu krönen, denn das war das große Ziel. Eine Stimulation, ohne Medikamente.
Ich hatte zu der Zeit meine Höchstdosis an Morphium intus, so dass ich durch das schnelle Herabsetzen dermaßen an Entzugserscheinungen litt. (zittern, Albträume, Kreislaufbeschwerden.)
„Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde,
als Eure Schulweisheit Euch träumen lässt.”
als Eure Schulweisheit Euch träumen lässt.”
William Shakespeare